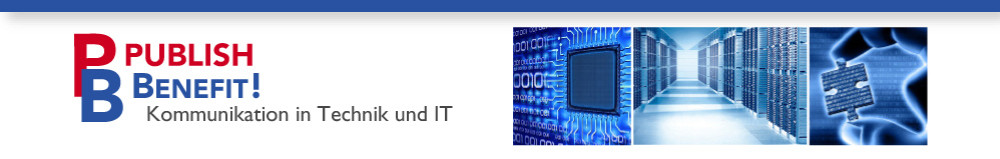Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 ist generative Künstliche Intelligenz (KI) erstmalig für eine breite Zielgruppe verfügbar. Mittlerweile drängen viele weitere KI-Tools auf den Markt. Die meisten basieren auf einem großen Sprachmodell (Large Language Model / LLM) und stellen eine benutzerfreundliche Chat-Oberfläche zur Verfügung.
Auch für die Erstellung von Texten kann die Technologie als praktischer Helfer im Berufsalltag dienen. Allerdings sind hierbei einige Besonderheiten zu berücksichtigen und Fallstricke zu umgehen. Werden die folgenden sieben Tipps beachtet, kann bei der KI-Texterstellung nichts schief gehen.
Tipp 1: Die richtige KI-Lösung auswählen
Auch wenn ChatGPT in der öffentlichen Wahrnehmung nach wie vor eine dominante Rolle spielt, ist sie beileibe nicht die einzige brauchbare generative KI-Lösung. Der Markt bietet für die Texterstellung noch viele weitere KI-Tools, die teilweise leistungsfähiger sind und besser zu bestimmten Anforderungen passen. Dazu zählen beispielsweise:
- Google Gemini: Ideal für schnelle Recherchen und Textvorschläge; integriert sich gut mit Google-Diensten.
- Jasper AI: Beliebt im Marketing; unterstützt bei Werbetexten, Produktbeschreibungen und SEO-optimierten Inhalten.
- ai: Legt den Fokus auf kurze, prägnante Texte wie Social-Media-Posts, Werbeanzeigen und E-Mail-Kampagnen.
- Writesonic: Bietet eine breite Palette an Textformaten, darunter Artikel, Landing Pages oder YouTube-Skripte.
- DeepAI Text Generator: Nutzt ein transformer-basiertes Sprachmodell für kontextbezogene Textgenerierung.
- Scribe: Besonders nützlich für das Zusammenfassen von Artikeln, das Schreiben von Berichten und akademischen Inhalten.
Tipp 2: Professionell prompten
Die Schlüsselfunktion generativer KI-Modelle ist das Prompten. Hierbei definiert der Nutzer per Eingabe in das Chat-Feld, welche speziellen Anforderungen er hat, was er wissen möchte oder welche Resultate er sich wünscht. Dabei kann er eine konkrete Frage stellen oder auch eine Anweisung erteilen. Je präziser und klarer diese Anfrage formuliert ist, desto genauer und umfassender wird auch das Ergebnis, das die KI ausgibt.
Ein Praxisbeispiel
Bezogen auf die Texterstellung kann ein einfacher Prompt beispielsweise lauten: „Erstelle einen fachlich fundierten Text zum Thema gesunde Ernährung.“ Genauer spezifizieren lässt sich diese Anweisung durch konkretere Angaben wie die erforderliche Textlänge, ein bestimmtes Format oder einen besonderen Schreibstil. Auch Vorgaben hinsichtlich der gewünschten Inhalte oder einer möglichen Struktur sorgen dafür, dass der Text noch präziser den Erwartungen entspricht. Ein spezifischer Prompt könnte also wie folgt formuliert sein: „Schreibe einen fachlich fundierten Text zum Thema gesunde Ernährung im Stil eines Ratgeber-Artikels mit einem Umfang von ca. 6.000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Der Text soll zunächst in einer Einleitung auf das Thema hinführen, dann allgemeine Aspekte einer gesunden Ernährung beleuchten und schließlich gesunde Lebensmittel konkret benennen.“
Tipp 3: KI gekonnt für die Recherche einsetzen
Generative KI eignet sich nicht nur für das Formulieren von Texten, sondern dient auch als nützliches Recherche-Tool. Mit einem präzise formulierten Prompt findet der Nutzer schnell und gezielt relevante Inhalte, die sich als Basis für die Texterstellung nutzen lassen. Dazu zählen etwa Definitionen von Begriffen, die Erklärung von Sachverhalten oder die Ausgabe von Listen. Ein entsprechender Prompt könnte lauten: „Erstelle eine Liste gesunder Lebensmittel.“ Ein hilfreiches KI-Recherche-Tool ist beispielsweise der Copilot, den User von Microsoft 365 bequem und kostenlos innerhalb des Internet-Browsers Edge nutzen können. Auch die KI-Suchmaschine Perplexity erweist sich als sehr nützlich für schnelle, faktenbasierte Recherchen und liefert präzise Antworten mit Quellenangaben.
Tipp 4: Der KI nicht blind vertrauen
So einfach und verlockend die Texterstellung per generativer KI auch sein mag – sie ist keinesfalls frei von Fehlern. Ähnlich wie das menschliche Gehirn basiert KI auf neuronalen Netzen. Diese benötigen eine große Menge an Daten, mit denen sie darauf trainiert werden, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern. Liegt keine ausreichende Datenbasis vor, ist auch der Output nicht optimal. In solchen Fällen neigen manche KI-Modelle dazu, zu „halluzinieren“, also Inhalte frei zu erfinden. Laut Recherchen des Mittelstand-Digital Zentrums Berlin enthalten – je nach Themengebiet – bis zu 73 Prozent der KI-Antworten sachliche Fehler. Dies belegen diverse aktuelle Studien.
Daher ist es von zentraler Bedeutung, KI-generierten Content kritisch und mit „gesundem Menschenverstand“ auf Richtigkeit und Konsistenz zu überprüfen. Zwar verursacht dies einen gewissen Aufwand, ist aber unerlässlich für die Erstellung inhaltlich korrekter Texte. Denn: Werden falsche Informationen in einem Text weitergegeben, haftet hierfür nicht die KI, sondern der menschliche Autor.
Tipp 5: Quellen verifizieren
Bei der Erstellung eines Textes greift generative KI auf Quellen im Internet zurück. Wir wissen jedoch nicht, ob diese vertrauenswürdig sind. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten die Fundstellen gewissenhaft überprüft werden. Manche KI-Lösungen wie etwa der Microsoft Copilot geben die Quellen in der Antwort an. Die Verifizierung der Quellen mag mühsam sein, ist aber dennoch dringend zu empfehlen. Denn als Urheber eines Textes sind wir für die Korrektheit der Inhalte verantwortlich.
Tipp 6: KI-Texte sprachlich optimieren
KI-generierte Texte sollten nicht nur auf inhaltliche Richtigkeit überprüft werden. Auch lohnt in vielen Fällen ein sprachlicher und stilistischer Feinschliff. Tatsache ist: KI-Texte lassen sich meist als solche erkennen – anhand von typischen Merkmalen. So weisen die Texte häufig sprachliche Schwächen auf, wie beispielsweise komplizierte Schachtelsätze, Passiv-Konstruktionen, Substantivierungen, Wortwiederholungen oder inhaltliche Redundanzen. Daher ist es dringend geboten, die KI-Texte zu optimieren. Dies gilt insbesondere für Artikel, die für professionelle Zwecke wie das Marketing oder die Unternehmenskommunikation genutzt werden. Bei der Optimierung der KI-Texte empfiehlt es sich, einen erfahrenen Content-Experten zu konsultieren. Diese Investition lohnt sich allemal: Denn nur sprachlich saubere und lebendige Texte können in Marketing und PR ihre Ziele erreichen – nämlich die Leser überzeugen, Nutzen kommunizieren und Produkte verkaufen.
Tipp 7: Eigene Kreativität in den Text bringen
Auch wenn generative KI ein praktischer Helfer für die Erstellung von Texten im Berufsalltag sein kann, sollten wir immer im Hinterkopf behalten: KI ist nicht kreativ, kann nichts Neues erschaffen und führt dadurch auch nicht zu optimalen Ergebnissen. KI durchforstet das Internet nach bestehenden Inhalten – und fügt diese zu einem Text zusammen. So ausgefeilt die Algorithmen auch programmiert sind – ein KI-Text wird niemals das journalistische Qualitätsniveau, die Kreativität, Lebendigkeit und Strahlkraft eines mit menschlicher Intelligenz erstellten Textes erreichen.
Kreative Textelemente wirken Wunder
Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, den KI-Text mit kreativen Elementen und sprachlichen Stilmitteln anzureichern. Hierfür eignen sich beispielsweise Metaphern, Wortspiele, Alliterationen oder einprägsame Geschichten. Empfehlenswert ist auch ein individueller Aufhänger für den Texteinstieg sowie eine knackige Überschrift, um gleich am Anfang die Neugier und Aufmerksamkeit der Leser zu wecken und sie buchstäblich in den Text zu ziehen. Denn nur durch eine solche persönliche Note werden die Texte lebendig, erhalten ein menschliches Antlitz und entfalten optimal ihre Wirkung bei der Zielgruppe. All das kann KI nicht leisten. Mit ihr lassen sich ganz passable Standardtexte erstellen. Für den Schritt von der Pflicht zur Kür ist aber – gerade bei professionellen Marketing- oder PR-Texten – das menschliche Gehirn ein unverzichtbarer Helfer.